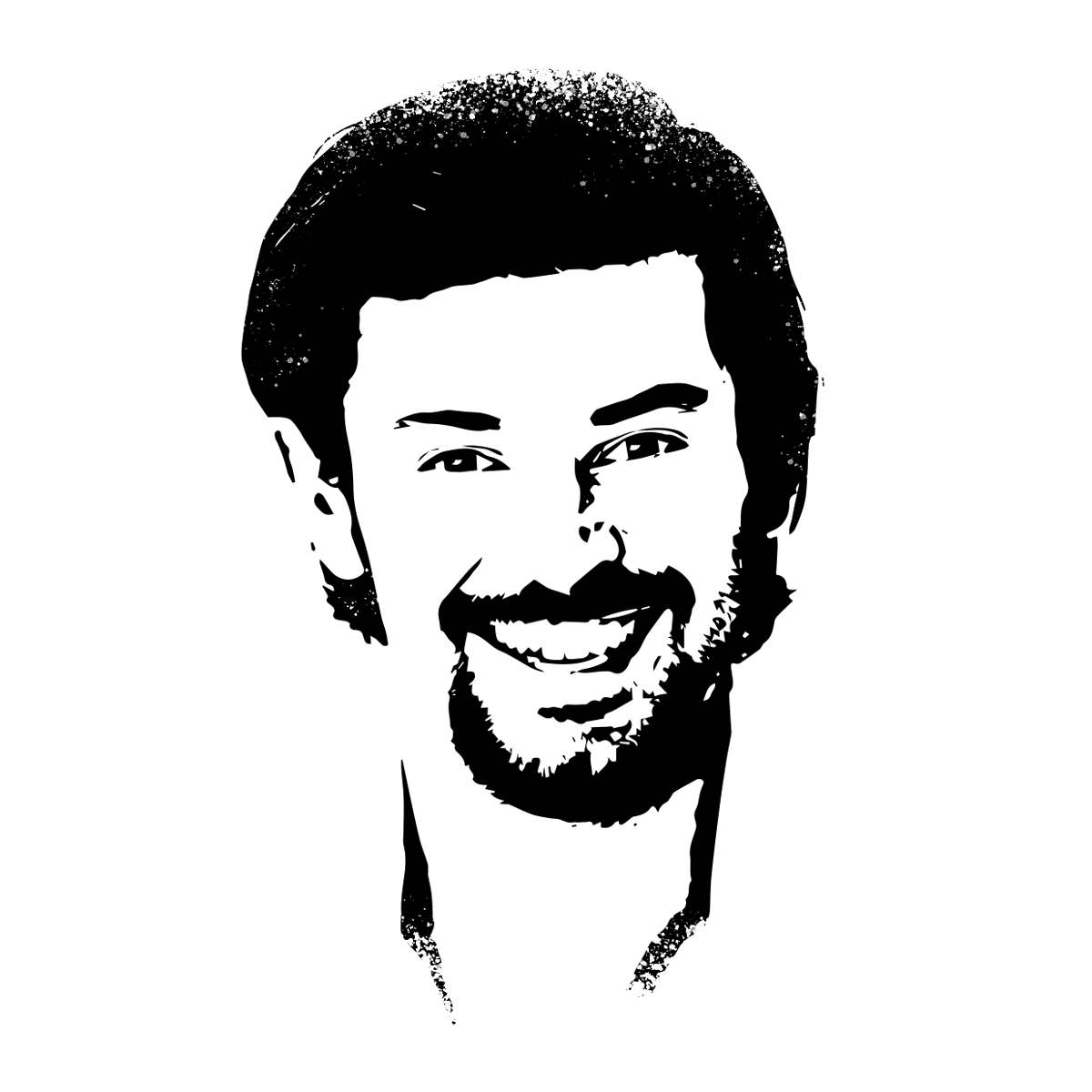Erfolgsfaktor: Can-Do-Haltung
Dr. Detlef Kurth ist Professor für Stadtplanung an der TU Kaiserslautern und hat als Leiter des Expertenbeirats maßgeblich am ersten Memorandum „Urbane Resilienz“ des Bundesministeriums des Innern, Bau und Heimat mitgewirkt. Mit dem 22316_MAG sprach er über die vielfältigen Herausforderungen von Städten, die Integration von Resilienz in Verwaltungen und seine Ideen für die Stadt der Zukunft.
22316_MAG: Herr Kurth, was verstehen Sie unter urbaner Resilienz und wie lange gibt es den Begriff schon?
Prof. Dr. Detlef Kurth: Generell gibt es den Begriff oder das Verständnis von Resilienz in der Stadtentwicklung noch nicht so lange. An Bedeutung gewonnen hat es mit dem Klimawandel und daraus folgenden Überflutungen wie „Katrina“ in New Orleans. Da kam man zu dem Schluss, angesichts zukünftig zunehmender Extremwettereignisse resilienter werden zu wollen. Für uns ist in der Debatte für das Memorandum jedoch wichtig gewesen, nicht nur widerstandsfähig und robust zu sein, sondern besser wiederaufzubauen und auch weitere Ziele wie Nachhaltigkeit zu verfolgen. Gleichzeitig wollten wir aber auch die Prävention stärken und schon vorher Städte so organisieren, dass sie weniger störanfällig sind. Die drei Dimensionen der urbanen Resilienz lauten deshalb: Widerstandsfähigkeit in der Krise, Prävention und Transformation.
Urbane Resilienz ist also mehr als nachhaltige Stadtentwicklung?
Ja, auf jeden Fall. Das Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung haben wir seit etwa 20 Jahren. In Deutschland ist es in der sogenannten „Leipzig-Charta“ manifestiert. Auch weiter-hin sollte unser Oberziel die nachhaltige Entwicklung sein, also ökonomisch, ökologisch, sozial ausgeglichen und zukunftsgerichtet. Die Resilienz sehe ich als ein zusätzliches wichtiges Element, aber nicht anstelle dessen. Sie gewinnt aber immer mehr an Bedeutung – nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch aufgrund von Pandemien, Versorgungskrisen und Kriegen wie die Invasion Russlands in die Ukraine.
Pandemien, Versorgungskrisen und Kriege haben Sie eben bereits erwähnt. Vor welchen anderen Herausforderungen stehen Städte und Gemeinden heute noch?
Die größte Herausforderung ist der Klimawandel. Zum einen bedeutet das Klimaschutz, also weniger Energie verbrauchen und CO2-freier werden. Zum anderen aber auch Anpassung an Extremwetter und Überhitzung. Weiterhin liegt eine große Herausforderung im demografischen Wandel. In unserer Gesellschaft findet eine massive Überalterung statt und es gibt zu wenige junge Menschen. Das macht sich jetzt schon bemerkbar, spätestens aber dann, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht. Um damit verbunden das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, brauchen wir Migration und Integration – eine weitere Herausforderung der Städte. Ein ganz wichtiger Punkt ist dann natürlich auch der Wandel des Handels. Der Einzelhandel in Innenstädten hat mit dem Online-Handel zu kämpfen. Digitalisierung ist aber eine riesige Herausforderung in allen Lebensbereichen. Mobilität ist ebenfalls ein großes Thema. Wir müssen wegkommen von den Verbrenner-Motoren. Zugleich müssen wir aber auch versuchen, generell weniger Autos in den Städten zu haben und den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Ein Hauptthema der Zukunft wird zudem die kritische Infrastruktur. Wir merken jetzt am Beispiel der Deutschen Bahn, dass wir gegen Angriffe auf unsere Infrastruktur nicht gut aufgestellt und geschützt sind. Da haben wir einen riesigen Nachholbedarf in Deutschland. Anschläge auf die kritische Infrastruktur können unsere Städte tatsächlich lahmlegen.
Zu tun gibt es also genug. Wie lässt sich Resilienz in den Alltag der Verwaltungen, Behörden und Rathäuser integrieren und wer hat in einer solchen Konstellation den Hut auf?
Resilienz muss in alle städtischen Planungsprozesse integriert werden. Wenn ein neues Wohngebiet ausgewiesen oder ein neues Flussbett angelegt wird, müssen diese Maßnahmen unter Risikofaktoren abgeschätzt werden. Dazu gehören sogenannte Vulnerabilitäten (Verletzlichkeiten). Das ist ein Planungsprozess, der viele Jahre andauern wird. Es braucht aber auch ein Risikobewusstsein, dass es bislang in deutschen Verwaltungen und auch in der Bevölkerung nicht gab. Vorwerfen kann man das den Menschen nur begrenzt, denn wir hatten ja nur sehr selten Katastrophen. Jetzt haben wir aber immer mehr Systemprobleme und hinken den aktuellen Entwicklungen im internationalen Vergleich etwas hinterher. Es hängt letztlich von jedem Stadtrat, von jedem Bürgermeister ab, wie schnell er reagiert. Aber auch von den Bundesländern und der Frage, ob sie das forcieren und eine koordinierende Aufgabe wahrnehmen. Auch muss es mehr Abstimmung zwischen den Kommunen geben. Das ist in Deutschland ein großes Problem. Einer Flutwelle wie der im Ahrtal ist es völlig egal, ob eine Stadtgrenze kommt und ein anderer Bürgermeister zuständig ist.
„Einer Flutwelle wie der im Ahrtal ist es völlig egal, ob eine Stadtgrenze kommt.“
Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für Städte und Kommunen?
Wir brauchen sogenannte Risikoanalysen in jeder Kommune und für jeden Bereich. Das kostet zunächst Geld. Teilweise liegen diese aber sogar schon vor. Es gibt auch Förderprogramme, die vielleicht ausgedehnt werden sollten. Generell sagen wir: Für langfristige Planungen und Analysen sollte etwas mehr Geld ausgegeben werden, denn dadurch verringern sich die Schäden um ein Vielfaches und es wird wiederum Geld gespart. Dieses Bewusstsein haben wir aber noch nicht in den Köpfen der Politiker, weil die natürlich nur in einem Zeitabschnitt von vier Jahren denken.
Welche Städte würden Sie als Vorreiter der urbanen Resilienz bezeichnen?
Auf Deutschland bezogen ist das schwierig, denn der Begriff ist hier ja noch relativ neu. Das heißt, man findet bereits einzelne Städte, die insbesondere bei der Klimaanpassung sehr weit sind. Im Hinblick auf den Klimawandel sind Freiburg und Karlsruhe zum Beispiel sehr gut aufgestellt. Städte, die sowieso extreme Hitze haben, besitzen schon seit Jahren sehr gute Strategien und schaffen es jetzt auch, diese um Resilienz zu erweitern. Europaweit nennen wir immer Rotterdam oder generell die Niederlande als Beispiel. Dort gab es schon immer eine Überflutungsgefahr und mittlerweile besteht eine sehr gute Planung, die auch wassersensibel ist. Wien hat schon seit Jahrzehnten gute Stadtentwicklungskonzepte. Seit kurzem hat Wien zudem ein Smart-City-Konzept, das Nachhaltigkeit, Resilienz, Klimawandel und Krisenvorsorge beinhaltet.
Wie groß ist ganz generell die Bereitschaft von Städteverantwortlichen, in urbane Resilienz zu investieren?
Das Bundesministerium für Bauen und Wohnen erwartet in Zukunft von jeder Stadt, insbesondere wenn sie Gelder aus der Städtebauförderung bekommen möchte, Resilienz-Konzepte aufzunehmen. Noch ist das eher eine Empfehlung und auch detaillierte Methoden gibt es noch nicht. Da sind wir wieder sehr langsam in Deutschland, aber das wird kommen.
Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überflutungen, Hurrikans oder Kriege – würden Sie sagen, dass andere Städte in der Welt im Vergleich zu deutschen Städten resilienter sind, weil sie lernen mussten, mit höheren Risiken umzugehen und schwierigere Zeiten zu durchstehen?
Ja, auf jeden Fall. In anderen Ländern gibt es ein viel stärkeres Bewusstsein für Katastrophen und Vorsorge. Es gibt bessere Notfallpläne und vielleicht auch mehr Ehrfurcht vor Naturereignissen. Die Ressourcen sind zwar oft geringer, aber das bedeutet nicht, dass sie das schlechter machen. In anderen Ländern gab es auch ohne den Klimawandel schon immer Fluten und Hurrikans und somit auch ein stärkeres Bewusstsein. Letztlich muss jedes Staatssystem überlegen, wie es damit umgeht. Ein entscheidender Punkt ist wirklich das Risikobewusstsein. In Deutschland merken wir ja jetzt auch gerade, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Strom immer fließt.
„Die Bürger selbst müssen mitgenommen, aufgeklärt und eingebunden werden.“
Apropos Risiken: Sie plädieren für ein integriertes Risiko- und Krisenmanagement. Was verstehen Sie darunter?
Zum einen verstehe ich darunter, gute Analysen zu machen und eine gute Datenbasis zu haben, um verletzliche Bereiche für Bewohner frühzeitig zu identifizieren. Bei der Ausweisung von neuen Siedlungen muss dann darauf reagiert werden. Zum anderen heißt das, Vorbereitungen zu treffen und Reserven zu haben für den Fall, dass die Krise eintritt. Es bedeutet aber auch, bestehende Infrastruktur und Siedlungsstrukturen zu verändern. Sie kleinteiliger zu machen, umzubauen und Stadterneuerung zu betreiben.
Eine resiliente Stadt fußt maßgeblich auch auf einer mündigen und handlungsfähigen Gesellschaft. Dazu zählen die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Politik, die Kirchen, die Sportvereine und vieles mehr. Wie kann diese Mammutaufgabe gelingen und wer sollte verantwortlich sein?
Hier hat der Baustadtrat oder der Planungsdezernent die Verantwortung. Es ist aber im Grunde eine interdisziplinäre Aufgabe, bei der natürlich auch der Landschaftsplaner, der Verkehrsplaner und viele weitere Experten beteiligt sein müssen. Am Ende natürlich auch der Bürgermeister. Die Bürger selbst müssen mitgenommen, aufgeklärt und eingebunden werden.

Prof. Dr. Detlef Kurth ist eingetragener Stadtplaner in der Architektenkammer Baden-Württemberg und Mitglied in der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Er hat 1992 ein Diplom für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin erworben. Seit 2017 hat Kurth die Professur am Lehrstuhl Stadtplanung an der TU Kaiserslautern im Fachbereich Raum- und Umweltplanung. Als Leiter des Expertenbeirats hat er das Memorandum „Urbane Resilienz – Wege zur robusten, adaptiven und zukunftsfähigen Stadt“ für das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat maßgeblich mitentwickelt.
Die Bürger sind ein gutes Stichwort. Wer sollte einen solchen Veränderungsprozess kommunikativ und im Dialog mit den Bürgern begleiten?
Seit 20 Jahren haben wir Quartiersmanager in der Stadterneuerung in Deutschland. Hier ist nur das Problem, dass diese ausschließlich in Gebieten eingesetzt werden, die als Erneuerungsschwerpunkte gelten – und das nur für ungefähr zehn Jahre. Energieberater und Klimamanager gibt es auf Stadtebene ebenfalls. Dieses System sollte man ausbauen. Die Idee ist aber auch, dass Nachbarschaftszentren entstehen und vielleicht mit nur einer kleinen Unterstützung der Kommune arbeiten. Hier können die sozialen Medien natürlich sehr hilfreich sein. Was aber fehlt, ist eine unabhängige Quartiers-Plattform, über die man sich vernetzen kann. An dieser Stelle ist sicher noch viel Optimierungsbedarf vorhanden.
Braucht es zukünftig auch Resilienz-Manager in Städten?
Wir brauchen mindestens eine Art Stabsstelle Resilienz bei den Bürgermeistern und den Stadtplanungsämtern. Diese fehlen bislang. Es hängt von der Größe der Stadt ab, wie groß eine solche Stabsstelle letztendlich ist. Tatsächlich brauchen wir aber in allen Städten und vor allem in den Risikogebieten einen Resilienz-Manager. Ob das der Klimamanager ist, der sich fortbildet, oder jemand neues, bleibt abzuwarten. Das Bewusstsein sollte aber da sein.
Wie sieht für Sie persönlich die perfekte und resiliente Stadt der Zukunft aus?
Dazu muss ich natürlich sagen, dass es die perfekte Stadt nicht geben wird. Für mich persönlich ist die perfekte Stadt eine kompakte und dichte Stadt der kurzen Wege und der Nutzungsmischung. Viele haben aufgrund des Klimawandels und der Resilienz gedacht, dass wir wieder entdichten und mehr in die Fläche gehen müssen. Stichwort: Einfamilienhaus. Dazu sage ich nein. Das Einfamilienhaus ist eigentlich nicht resilient. Wir wollen weiter bewusst kompakt sein und auch eine entsprechende Infrastruktur haben. Aber diese kompakte Stadt muss grüner werden, mehr Wasserthemen berücksichtigen und sie muss in Zukunft mehr multiple Nutzung ermöglichen. Zudem muss sie ein Ort des sozialen Ausgleichs sein. Das Thema des Risikobewusstseins und der Nachbarschaft ist zudem sehr wichtig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die gemischte, kleinteilige, europäische Stadt schon viele Jahrhunderte überlebt hat. Deshalb müssen wir auch kein komplett neues Modell auflegen, aber es gibt einen hohen Bedarf an Anpassungen.